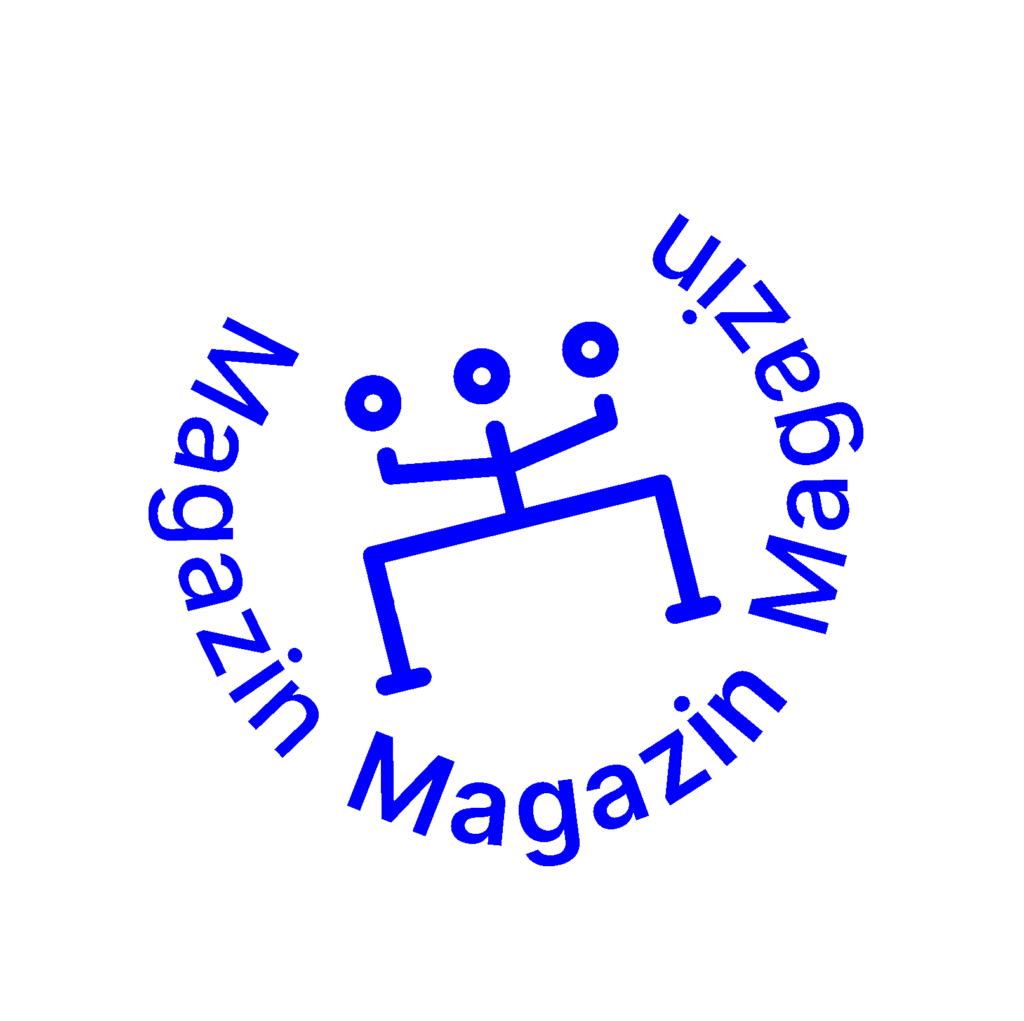
Hier posten wir Beiträge zu zentralen Themen rund um soziale Innovationen für das Alter(n). Bestenfalls finden Sie darin Ihre Fragen und Themen wieder. Lassen Sie sich inspirieren.


Omas gegen Rechts.
Ein Interview mit Jutta Shaikh
„Wir sind alt, aber wir sind nicht stumm“.
Interview mit Jutta Shaikh, Sprecherin von Omas gegen Rechts Frankfurt am Main und 2. Vorsitzende von Omas gegen Rechts Deutschland vom 13.5.2024 via Zoom. Das Interview führten Dr. Maria Keil und Veronika Schneider.
Wollen Sie sich und Omas gegen Rechts kurz vorstellen?
Ich bin seit über fünf Jahren jetzt bei Omas gegen Rechts aktiv. Damals war‘s eine noch kleine Gruppe. Inzwischen haben wir weit über 150 Gruppen bundesweit. Und wir wachsen, jede Woche kommen zwei bis drei Gruppen dazu, seit dem Correctiv-Report1 haben wir über 60 neue Gruppengründungen. Es ist sehr dezentral bei uns, aber wir haben so 30.000 bis 35.000 Mitglieder in Deutschland. Unser Motto ist „Wir sind alt, aber wir sind nicht stumm“.
Wir gehen auf die Straße, wir machen Schulungen, Argumentationstrainings, wir gehen in Schulen und Kindergärten. Wir haben eine Kinderbuch-Vorlesegruppe, wo den Kindern spielerisch vermittelt wird, dass man niemanden ausgrenzen darf, wegen seiner Herkunft, seiner Religion oder weil er oder sie ein bisschen anders aussieht. In den Schulen machen wir Workshops zu Zivilcourage gegen Hass und Hetze.
Dann haben wir einen Chor, bald werden wir wahrscheinlich auch eine Theatergruppe haben. Sportlich bleibt man sowieso, wenn man auf der Straße ist.
Und wir sind sehr bunt gemischt, so dass wir aus den verschiedensten Bereichen auch Qualifikationen haben, die die Leute mit einbringen können. Wir können da auch auf ein ganz schönes Repertoire von beruflichen Erfahrungen zurückgreifen. Alles ist ehrenamtlich, wir haben keine bezahlte Stelle.
Ja und wir zoomen jetzt. Vor Corona, wenn mich jemand gefragt hätte, was ist Zoom, dann hätte ich mit den Schultern gezuckt, inzwischen habe ich jeden Tag ein Zoom-Meeting. Man lernt aus der Herausforderung. Und auch das lässt einen… man fühlt sich ganz gut danach.
Wie sind sie denn überhaupt zu den Omas gegen Rechts gekommen? Wie haben Sie davon gehört und was war der Grund sich denen anzuschließen?
Meine Familie ist sehr multikulturell. Meine Kinder sind erfolgreich, haben studiert, sind erfolgreich im Büro, haben Familien, trotzdem würden sie nach dem Bild einer AfD nicht dazu gehören. Und wer hat das Recht sich anzumaßen, wer dazu gehört und wer nicht? Wenn solche Leute mächtig werden, passiert sowas wie in Hanau. Und das ist unglaublich und beängstigend. Das ist der persönliche Grund.
Und dann habe ich ganz zufällig im Fernsehen einen Bericht über die Omas gegen Rechts gesehen und dachte, das ist es und eine Woche später habe ich mich angemeldet und das hat nicht lange gedauert, dass ich da wirklich mit Herz und Seele dabei war. Und wenn ich was mache, dann mache ich es halt auch wirklich. Inzwischen ist es sehr viel.
Wie kann man sich denn anmelden? Bei wem meldet man sich? Muss man sich melden?
Wir sind viel mit eigenen Veranstaltungen auf der Straße, haben immer Listen ausliegen, wo Leute sich eintragen können, dann bekommen sie den Newsletter und dergleichen. Wir haben jetzt auch Webseiten, wo man sich erkundigen kann, gibt’s da schon eine Gruppe, wenn es keine Gruppe gibt, können wir auch unterstützen, dass eine Gruppe aufgebaut wird. Mit drei, vier Leuten kann man gut anfangen, das wächst dann ganz schnell. Wir helfen bei der Bekanntmachung, bei den Materialien.
Würden Sie sagen, Omas gegen Rechts haben schon Ziele erreicht?
Das wichtigste Ziel ist für uns zu erreichen, dass die Würde aller Menschen unantastbar ist, egal wo sie herkommen und welche Religion sie haben. Das heißt, wir sind gegen Antisemitismus, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Frauendiskriminierung, überhaupt gegen Diskriminierung auch von LGBT und Behinderten… Niemand darf ausgegrenzt werden. Das andere Thema ist: Ja, wir sind für etwas mehr soziale Gerechtigkeit, ich glaube, das brauchen wir auch, wenn der Staat stabil bleiben soll. Und wir unterstützen die jungen Menschen, zum Beispiel von Fridays for Future, die sich für die Umwelt einsetzen. Denn sicherlich werden zu viele Ressourcen verbraucht und ressourcenmäßig weit über unsere Verhältnisse gelebt. Wir sind durchaus nicht radikal, aber laut. Und wir erinnern, gedenken und wir mahnen. Denn wenn man ruft: „Nie wieder ist jetzt!“, muss man ja wissen, was das „nie wieder“ bedeutet.
Unser Ziel hätten wir erreicht, wenn die AfD unter fünf Prozent liegt. Und wenn es keinen Rassismus mehr gäbe und wir uns selbst überflüssig gemacht hätten. Aber da sind wir leider noch weit davon weg. Ein Ziel haben wir sicher erreicht, dass unsere Stimme gehört wird, auch von der Politik. Denn so 30 000 bis 35 000 Wählerstimmen schiebt man auch nicht einfach so vom Tisch.
Wie ist das mit dem Namen? Wie finden Sie den Namen und was hat der Name für eine Geschichte?
Der Begriff Oma… die meisten Leute sind ganz happy damit. In der Gesellschaft gibt es eine positive Assoziation mit dem Begriff. Und ich glaube, dass uns das in der Bewegung sehr wohl hilft. Denn mit einer Oma… Gut, das ist jetzt nicht so typisch, dass die Oma auf der Straße ist und demonstriert, laut ist und ihre Stimme erhebt, das ist das Untypische. Aber was typisch ist, bei uns gibt’s keine Krawalle. Wir machen das friedlich. Der Begriff Omas ist ein Begriff, der Vertrauen schafft, nicht mit Korruption und Gier in Verbindung gebracht wird. Und es geht ja auch wirklich darum, es für unsere Kinder und Enkel zu tun. Und wir erleben weniger Aggressionen… Selbst ein Rechter scheut sich vielleicht uns anzugreifen, der denkt: „Ich habe ja auch ‘ne Oma“… Verbal werden wir inzwischen schon mal angegriffen aber wirklich handgreiflich… kann man an einer Hand abzählen, was da stattgefunden hat, seit wir existieren.
Das ist vielleicht eine gute Überleitung, ich habe mich noch gefragt, sehen Sie Vorteile, die das höhere Alter mit sich bringt im Kampf gegen Rechts?
Den einen Vorteil habe ich schon gesagt, dass wir weniger angegriffen werden. Der andere Vorteil, dass man älter ist: Man hat mehr Zeit, man muss sich vielleicht auch ab und zu mal ausruhen, aber man hat mehr Zeit. Man hat auch eine gewisse Lebenserfahrung die man einbringen kann. Der Nachteil ist, wir müssen alle überlegen, wie viele Jahre macht das jede von uns. Manche kommen mit dem Stock, manche kommen mit dem Rollator.
Es gibt viele Möglichkeiten, auch wenn man älter ist, sich einzubringen. Wir haben auch Omas, die richtig wieder aufleben durch diese Aktivität. Weil sie sich in einer Gruppe wiederfinden, weil sie was Sinnvolles machen, weil sie was bewegen können, weil sie mit Leuten kommunizieren, weil sie aktiv sind. Deren innere Einstellung zum Leben verändert sich dadurch auch. Ich habe vor ein paar Wochen die Bürgermedaille der Stadt Frankfurt bekommen für mein Engagement, das habe ich in meinem ganzen beruflichen Leben nicht bekommen…
Ja das haben wir gelesen, herzlichen Glückwunsch!
Das ist auch ein Anreiz für Omas, sich für ihre Enkel einzusetzen, also soziales Engagement wird auch anerkannt und gesehen.
Danke für Ihre Zeit und das interessante Interview!
Gute Woche!

Am Anfang steht die Vision
Dr. Maria Keil
“Utopien sind nicht nur Instrumente, die Zukunft auszumalen, sondern dienen auch der Vermessung der Gegenwart.” Gero von Randow (Utopia jetzt)
Mit dem „Index Soziale Innovation für das Altern“ (PosIA-Index) zeigen wir positive, bunte Zukünfte. Aber ist das der richtige Weg? Haben wir nicht genug Probleme, Missstände, manchmal sogar Verbrechen zu bekämpfen?
Ja, es gibt Probleme und Herausforderungen. Und sie wurden und werden schon oft beschrieben. Wir kennen Überschriften wie “Unerträgliches Dahin-Vegetieren pflegebedürftiger Menschen” (krankenkassen.net). Es gab auch schon unzählige Versuche, Reformen, Leitlinien, Gesetze, Empfehlungen, um sie anzugehen – meist wenig erfolgreich. Es fehlt der lange Hebel: beim Personalmangel in der Pflege und Altershilfe oder zur Beantwortung der Frage, wie wir mit der Verschiebung der Altersstruktur infolge des demografischen Wandels umgehen.
Diese und zahllose andere Probleme – nicht nur in der Pflege – werden im PosIA-Index nicht mehr benannt. Deswegen sind diese Probleme jedoch nicht verschwunden, und eigentlich stehen sie sogar ganz am Anfang. Nämlich am Anfang all der Anstrengungen, die dazu beigetragen haben, dieses Instrument Index zu entwickeln. Dabei wurde danach gefragt, wie überwunden werden kann, dass alternde Menschen bevormundet werden, dass sie unsichtbar gemacht werden, eingesperrt, gedemütigt und übergangen. Die Antwort darauf ist, dass es um eine positiv formulierte Orientierung gehen muss, also um Vorstellungen davon, wie es besser werden kann. Und auf welchen Wegen dies gelingt. Für den PosIA-Index wurde dafür aus Projekten geschöpft, die beispielhaft sozial innovativ Lösungsansätze gefunden haben und dabei sind, diese Ideale umzusetzen.
Es geht nicht darum, dass wild Veränderungen angestoßen werden. Auch nicht, wenn diese Veränderungen im einzelnen Fall sogar helfen, einen Missstand abzustellen. Es geht um die Richtung der Veränderung. Wohin zielen die Aktionen im Großen und Ganzen? Soziale Innovation heißt nämlich vor allem, dass es einen Willen gibt, das Handeln der Akteur:innen für eine bestimmte Sache so zu verändern, dass es vor allem jenen Menschen besser geht, die bisher ausgeschlossen oder benachteiligt waren. Soziale Innovationen sind mehr als nur sozialer oder kultureller Wandel. Denn dieser passiert einfach so. Das Leben der Menschen verändert sich ständig. Vor 100 Jahren sprachen wir anders, kleideten uns anders und so weiter. Sprache, Moden, Umgangsformen ändern sich, ohne dass es einen Plan oder ein Ziel dahinter gibt. Ein gewollter Wandel in eine bestimmte Richtung ist gemeint, wenn von sozialer Innovation die Rede ist.
An dieser Stelle kommt die Vision ins Spiel oder auch die Utopie. Eine Utopie ist ein Entwurf für eine fabelhafte Zukunft oder einen perfekten Ort, den es nicht gibt. Das Wort Topos, das in Utopie enthalten ist, ist Altgriechisch und heißt: Ort. Das davorstehende U heißt: nicht. Zusammengesetzt ist die U-Topie also ein Nicht-Ort oder ein Nirgendland. Und hier gibt es freilich eine Unterscheidung zwischen der Vision und der Utopie. Das Wort Vision bedeutete im Mittelalter Traumgesicht. Das Wort ist dem Lateinischen entlehnt, in dem es eigentlich Sehen oder Anblick meint. Die Vision hat konkrete Anhaltspunkte und kann realistische Vorstellungen für eine zukünftige Umsetzung und planbare Zukunft sein. Die Utopie dagegen ist Utopie, weil sie utopisch ist, weil sie uns nicht umsetzbar erscheint. Der Gelehrte und englische Beamte Thomas Morus gilt als Erfinder der Utopie. Er erzählt im Jahr 1516 von solch einem Nirgendland in seinem Buch „Utopia“. Die Insel „Utopia“ ist ein Traumland, wo Menschen gerecht und zufrieden gleichberechtigt miteinander leben. Grund und Boden besitzen alle gemeinsam. Alle bilden sich gemeinschaftlich und arbeiten für die Gemeinschaft. Und nicht zuletzt kann jede:r seine Religion frei ausüben. Dies alles stand im krassen Gegensatz zur Wirklichkeit seiner Zeit. Wenige besaßen das meiste Land, viele arbeiteten unfrei, hatten keinen Zugang zu Bildung und Menschen mit anderen religiösen Ansichten wurden mitunter gefoltert, verfolgt und getötet. Neben „Utopia“ von Morus gibt es viele weitere utopische Romane, z.B. „Herland“ (1915) von Charlotte Perkins Gilman. Gilman beschreibt eine ideale Gesellschaft frei von Krieg und Herrschaft, weil die Gesellschaft nur aus Frauen besteht.
Der „Index Soziale Innovation für das Altern“ changiert zwischen Utopie und Vision. Die Einen sagen, er sei visionär, für Andere erscheint er utopisch. Und ich finde beides in Ordnung. Denn das Sich Ausmalen einer bestimmten Art von Zukunft – ob nun als Vision oder als Utopie – macht erst sichtbar, was in der Gegenwart fehlt oder von der Utopie aus gesehen falsch wirkt. Visionen oder Utopien sind für die Gegenwart wie eine Schablone. Als Schablone erhalten sie die Wirkmacht eines Werkzeugs. Die Gegenwart kann mit dem Bild der Utopie oder der Vision abgeglichen, bemessen und bewertet werden. Wenn uns ein Bild vor Augen gehalten wird, wie es auch ganz anders und wirklich gut sein könnte, dann entsteht für uns gedanklich ein Abstand zur gegenwärtigen Situation und damit auch ein Stachel. Ein Stachel, der sich in uns bohrt und der nach Veränderung ruft: Wir müssen und wollen diesen Abstand verkleinern, um in Zukunft näher an der Utopie zu sein.
“Utopien sind nicht nur Instrumente, die Zukunft auszumalen, sondern dienen auch der Vermessung der Gegenwart.” Gero von Randow (Utopia jetzt)
Quellennachweise:
Krankenkassen.net, zuletzt zugegriffen 4.5.2023, https://krankenkassen.net/pflegereform/pflegenotstand/der-mensch-als-kostenfaktor.html.
Bundesverband Freie Darstellende Künste: “Utopia jetzt” Bundeskongress 2020, S. 11, https://utopia-jetzt.de/images/Downloads/PH_Bundeskongress2020.pdf.
Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch. 25. Aufl. v. Elmar Seebold, Berlin/Boston 2011.

Möglichkeitsräume
Warum wir Soziale Innovationen brauchen
Caroline Rehner
Am Ortsrand von Tokyo, Japan, befindet sich eine kleine, multifunktionale Pflegewohnanlage, „takurosho“ genannt. Sie besteht aus vier miteinander verbundenen Häusern, die alle durch gemeinsam genutzte Gärten und Zufahrtswege miteinander verbunden sind.
In einem Haus wohnen Menschen mit Demenz. Ein anderes wird als Tagespflege genutzt, wo Bewohner:innen und Besucher:innen zusammenkommen. Die Frau, die hier arbeitet, bringt jeden Tag ihr Kind mit. Spielzeug liegt auf dem Boden. Zwei andere Gebäude dienen ganz unterschiedlichen Zwecken: Bewohner:innen und Besucher:innen teilen sich einen Gemeinschaftsraum, einen improvisierten Süßigkeitenladen, eine Kalligrafieschule, eine Küche, wo alle gemeinsam kochen. Im Restaurant der Anlage essen oft Studierende aus der Umgebung zu Mittag. Auf den Regalen stapeln sich bunte Tassen, die Menschen aus der Nachbarschaft, die hier häufiger herkommen, von zu Hause mitgebracht haben. Im Gemeinschaftsraum können Eltern Liegetücher für ihre Babys ausleihen. Es gibt Zimmer für Bewohner:innen und auch kleine Wohnungen, in denen Menschen, die in der Anlage helfen wollen, für weniger Miete unterkommen.
Die Gebäude befinden sich entlang eines Weges, der von einer viel befahrenen Straße abzweigt. Ursprünglich war der Weg von der Straße durch eine Steinmauer abgetrennt. Als die Idee zur Pflegewohnanlage entstand, wurde als allererstes diese Mauer niedergerissen. Jetzt nehmen Anwohner:innen und Schulkinder diesen Weg als sichere Abkürzung zur Schule oder zu einem Park. Sie laufen hier an Blumenbeeten und Kletterbäumen, Gartenutensilien und Spielzeug vorbei, kaufen Süßigkeiten und verweilen öfter länger.
(Das Beispiel stammt aus: Hauderowicz, D. & Serena, K. (Hrsg.): Age-Inclusive Public Space, Berlin 2020. S. 130-137.)
*
Wie wird unsere Zukunft, wie wird das Alter(n) in Zukunft, aussehen? Wie soll das Altern in Zukunft aussehen? In der Nachbarschaft, in der Stadt, im Land – und über nationale Grenzen hinweg.
Zur Gestaltung unserer Zukunft brauchen wir eine gemeinsame Richtung, eine Vision, wie diese Zukunft – in vielfältiger Form – aussehen kann. Wir müssen Möglichkeitsräume denken, ausprobieren und dann auch schaffen. Wir brauchen Ideen, Konzepte und Strategien, wie die sozialen Räume aussehen sollen, in die hinein wir altern wollen – für akute Bedarfslagen und vorausschauend für langfristige Ziele.
Ob es um bedarfsgerechtes und zugleich schönes Wohnen geht, barrierearme Gestaltung öffentlicher Räume oder Mobilität im eigenen Umfeld, ob es um ganzheitliche Gesundheitsleistungen oder aktivierende Pflege geht, um lebenslange Bildung, Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen, Möglichkeiten der Mit-Gestaltung in der Kommune oder um neue kulturelle Alternsbilder – in all diesen Bereichen und bereichsübergreifend müssen wir inklusives Zusammenleben fördern. Wir müssen Wege finden, um die Grundrechte auf Teilhabe, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit alternder Menschen zu realisieren. Viele alternde Menschen wünschen sich beispielsweise, als Individuen ohne Stigmatisierung wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, ein aktives Leben zu führen, sich lebenslang weiterzubilden, schöpferisch tätig zu sein und ihren Ressourcen entsprechend frei zu entfalten.
Häufig aber entspricht die Art und Weise, wie Altern erlebt wird, nicht dem, wie es sein soll und wie es sich Menschen wünschen. Alternde Menschen, insbesondere Menschen, die Krankheit und einen Verlust von Fähigkeiten erfahren, die Hilfe bedürfen, sozialökonomisch benachteiligt sind oder jene, die nicht der ‚Mehrheitsgesellschaft‘ entsprechen – beispielsweise queere Menschen, introvertierte Menschen oder Menschen mit Behinderung oder Migrationsgeschichte – erfahren Formen von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Demütigung. Kränkung, Bevormundung, Vernachlässigung oder Gewalt prägen die Lebenswelt und können auch die eigene Selbstwahrnehmung beeinflussen.
Und auch die großen, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungslinien haben Einfluss. Demographischer Wandel und Pflegenotstand, Generationenkonflikte, soziale Folgen von Ungleichheit, Klimawandel, Folgen der Globalisierung, eine zunehmend angespannte politische Lage sind wachsende Herausforderungen für Menschen jeglichen Alterns.
Stellen wir uns einmal vor, wir hätten die Wahl: Würden wir in die Gesellschaft, wie sie aktuell besteht, überhaupt hineinaltern wollen? Viele – ältere wie jüngere – Menschen beschränken ihre aktive Teilhabe und ziehen sich ins private Umfeld zurück, teilweise bis hin zur Isolation.
Wir brauchen gesamtgesellschaftliche Initiativen, die solche sozialen Räume möglich machen, die dazu einladen, aktiv teilzuhaben und mitzumachen. Dafür müssen wir zunächst einmal Formen von Demütigung oder Exklusion alternder Menschen verringern. Ziel aller Veränderung ist das ganz alltägliche Erleben von Menschenwürde, wie sie in den Menschenrechten, dem Europarecht, dem Grundgesetz und in den Sozialgesetzbüchern benannt, wenn auch nicht in alltagspraktischer Form beschrieben wird.
*
Braucht es dafür immer etwas Neueres, Besseres, Kreativeres, Digitaleres – vermeintlich Innovativeres? Sind bisherige Projekte nicht gut genug?
Unter den Steigerungsformen neu, besser, kreativer lassen sich Soziale Innovationen nicht ausreichend fassen: Nicht alles, was neu und kreativ ist, ist im Sinne gemeinschaftlicher Werte wirklich gut. Nicht alles, was digital ist, kann ganzheitlich an komplexe soziale Zusammenhänge und Problemlagen andocken.
Soziale Innovationen können Ideen, Konzepte, Technologien, Strategien oder Organisationsformen sein. Gemeinwohlorientierte soziale Innovationen, nach denen wir suchen, verbinden einige Charakteristika, die deutlich spezifischer sind als der reine – auch ökonomische – Fortschrittsgedanke von etwas Neuem.
Soziale Innovationen verändern grundlegend die Funktionsweise eines Systems. Sie docken an soziale Praktiken, Strukturen und Einstelllungen an und zielen auf eine Veränderung des sozialen Miteinanders im System.
Soziale Innovationen sind gemeinwohlorientiert. Sie verändern das System, die Einstellungen und sozialen Praktiken so, dass die Vulnerabilität von Menschen und der planetaren Gesundheit gemindert und die Resilienz gesteigert wird.
Soziale Innovationen tragen zur Realisierung von Grund- und Menschenrechten bei. Dies ist eine Spezifizierung der Idee des Gemeinwohls. Sie fördern ein inklusives Zusammenleben, indem sie zur Teilhabe, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit einzelner Menschen oder von Gruppen beitragen und Demütigung und Exklusion verringern.
Folgende Beispiele illustrieren, auf welche Art und Weise soziale Innovationen umgesetzt werden können:
Was ist sozial innovativ? – Beispiel 1
Es werden nicht nur einzelne Rampen in einem Pflegeheim errichtet, sondern es wird, unter partizipativem Einbezug verschiedener Zielgruppen, ein umfassendes Konzept für ‚Universelles Design’ – das heißt Design, das für möglichst viele Menschen problemlos nutzbar und dabei ästhetisch ansprechend ist – in einem Quartier erarbeitet.
Was ist sozial innovativ? – Beispiel 2
Es wird eine vielseitige Kampagne für Alternsbilder initiiert, die über geeignete Diffusionskanäle – z.B. ein Podcast, ein Museum, ein Schulungsformat – vielfältige und ressourcenorientierte Alternsbilder vermittelt und dabei Perspektivwechsel ermöglicht (z.B. durch intergenerationellen Austausch, durch Kunst, oder auch technisch durch multisensorische Stimulation mittels Virtual Reality Brillen).
Was ist sozial innovativ? – Beispiel 3
In einer Gemeinde wird eine hybride (digitale und analoge) Plattform geschaffen, eine Art ‚Zukunftslabor‘, in der Menschen aus verschiedenen Generationen zusammenkommen, um, bedarfsorientiert, die Entwicklung ihrer Gemeinde gemeinsam zu gestalten und verschiedenartige Angebote zu entwickeln.
Aus den hier skizzierten Beispielen leiten sich einige weitere charakteristische Eigenschaften sozialer Innovationen ab, die deren Vorteile und Nutzen zeigen.
Soziale Innovationen sind visionär. Sie haben eine Richtung, eine Vision einer besseren Zukunft.
Soziale Innovationen sind werteorientiert. Bei der Umsetzung ihrer Vision orientieren sie sich an gemeinsamen Werten und machen die Werte selbst zum höchsten Ziel – egal ob in gemeinnütziger oder privatwirtschaftlicher Organisationsform.
Soziale Innovationen sind tiefgreifend. Statt nur punktuelle und befristete Einzelmaßnahmen zu sein oder oberflächliche Verbesserungen bestehender Strukturen vorzunehmen, greifen sie auf Ebene gesellschaftlicher Strukturen, des Handelns und der Werte an und verändern Umgebungen, Netzwerke, Organisationsformen und Einstellungen nachhaltig. Sie erzeugen systemischen Wandel, neue Denkweisen, neue soziale Praktiken.
Soziale Innovationen sind ganzheitlich. Sie reagieren auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedenster Bedarfslagen mit ganzheitlichen Lösungsansätzen, die das Wissen unterschiedlichster Professionen und die Erfahrungen unterschiedlichster Menschen und Expert:innen bündeln. Sie stoßen Wissenstransfer an und vernetzen sich auch über nationale Grenzen hinweg. Sie nutzen bestehende (Welfare-)Netzwerke, um ihre Mission zu diffundieren.
Soziale Innovationen sind prozessorientiert. In ihrem Zentrum stehen Lernprozesse. Offen, flexibel und anpassungsfähig reagieren sie auf aktuelle Bedarfslagen und dynamische Veränderungen und finden vorausschauend Lösungen für zukünftige Herausforderungen. Spielerisch-explorativ testen sie immer wieder Ideen und Lösungsansätze. Kritisch reflektieren sie auch sich selbst und wachsen daran.
Soziale Innovationen sind partizipativ. Sie stellen die Bedarfe der Zielgruppen an erste Stelle und binden diese von Anfang an in die Gestaltung ein, beziehungsweise organisieren die Gestaltung von Beginn an mit ihnen zusammen.
Soziale Innovationen sind aktivierend. Sie streben möglichst hohe Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit der Zielgruppen und eine sich selbst regulierende Umsetzung an. In einzelnen Fällen kann das dazu führen, dass eine Initiative von Beginn an ihr eigenes Ende mitbedenkt und einplant, weil sie so eigenverantwortlich von den Zielgruppen angenommen und so eigendynamisch umgesetzt wird, dass sie als Initiatorin gar nicht mehr gebraucht wird.
Soziale Innovationen sind Kollektivgut. Sie öffnen sich zur Teilhabe und machen sichtbar, dass sie gegenüber besonderen, zum Beispiel kulturellen oder geschlechtlichen, Bedarfen sensibilisiert sind und Vielfalt schätzen. Sie lassen zu, dass die Zielgruppen das Projekt aktiv mitgestalten und dass neue soziale Dynamiken in vernetzten Sozialräumen das Projekt verändern. Sie stellen ihr erworbenes Wissen, ihre Erfahrungen und Ergebnisse öffentlich, transparent und ansprechend zur Verfügung.
Soziale Innovationen sind inspirierend. Sie regen zur Nachahmung an und entwickeln Strahlkraft über den unmittelbaren Sozialraum hinaus.
Soziale Innovationen sind nachhaltig wirksam. Soziale Innovationen streben ‚Outcomes‘ – Wirkung bei den Zielgruppen – und ‚Impact‘ – Wirkung auf Ebene der Gesellschaft – an. Sie planen, analysieren und verbessern ihre Wirkung von Beginn an.
Soziale Innovationen sind mutig. Soziale Innovationen regen Veränderungen in komplexen Systemen an. Das erfordert Überwindung und Mut, da der Beginn einer Veränderung neue, unvorhergesehene Bedarfe und Herausforderungen generieren kann, die in komplexen Systemen trotz guter Planung nie genau vorhersehbar sind. Auch stoßen Veränderungen häufig auf Widerstände von außen, weil sie ungewohnt, anspruchsvoll, ja überfordernd wirken können. Soziale Innovationen stellen sich diesen Herausforderungen und lernen und entwickeln sich mit den Aufgaben, die ihnen begegnen.
*
Soziale Innovationen erfordern Mut. Aber sie ermöglichen es auch, dass man an den Zielen und Aufgaben wächst, dass man Selbstwirksamkeit spürt, weil man etwas in Bewegung setzt, dass man Sinnhaftigkeit in seinem Wirken erfährt, dass man sich in Resonanz mit seiner Umgebung befindet.
Soziale Innovationen sind nicht zwangsläufig teuer oder schwierig umzusetzen. Hoch professionalisierte und niedrigschwellige Maßnahmen können gleichermaßen innovativ wirken. Es kommt nur darauf an, wie passgenau sie an spezifische Bedarfslagen und Möglichkeiten vor Ort zugeschnitten sind und wie wirksam und nachhaltig sie jeweils umgesetzt werden.
Mit einer Vision fängt es an. Und damit, dass Zeit und Raum für gemeinsame Lernprozesse geschaffen werden. Alles weitere folgt Schritt für Schritt. Manchmal spielerisch, manchmal zufällig. Sicherlich anders als erwartet. Und genau das soll es auch sein: anders als gewohnt. Aber passend dazu, was sich Menschen wünschen und worauf sie ein Recht haben.
Welche Sozialen Innovationen möchten Sie aus Ihrem Kontext heraus anregen oder umsetzen? Schreiben Sie uns an info@posia.org und teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen.

Gesellschaftlichen Wandel gestalten!
Veronika Schneider
Wir wollen mit dem „Index Soziale Innovation für das Altern“ (PosIA-Index) beitragen zu einem gesellschaftlichen Wandel. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in die wir gerne hineinaltern. Eine Gesellschaft, in der Menschenwürde – also Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Teilhabe für Menschen in jedem Alter – eine Selbstverständlichkeit ist.
So ist es im Moment leider noch nicht, deshalb muss sich die Gesellschaft verändern. Aber was genau heißt gesellschaftlicher Wandel? Warum ändern sich Gesellschaften und was trägt dazu bei? Und was hat der PosIA-Index damit zu tun?
Ich werde mich der Sache annähern, indem ich ein Modell von Veränderungsebenen vorstelle, das die großen Fragen gliedert, so dass sie handhabbarer werden und über sie leichter nachgedacht werden kann.
Vielleicht der wichtigste Schritt ist, sich klarzumachen, dass Gesellschaft veränderbar ist. Dinge, die uns umgeben, Häuser, Straßen, Städte, aber auch Umgangsweisen, Traditionen, Gewohnheiten sind von Menschen gemacht. Diese Menschen hatten bewusste oder unbewusste Vorstellungen und Interessen, waren geprägt von der Zeit und dem Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind. Es lohnt sich zu fragen: Warum ist es so, wie es ist? Wer hat dafür gesorgt? Was hatte diese Person (oder diese Personen) für Interessen? Und wie könnte es anders sein?
Man kann sich dabei verschiedene Ebenen des Wandels anschauen:
Die materielle Ebene: Manchmal auch technische Ebene genannt. Das sind die Dinge, die uns umgeben. Zum Beispiel Smartphones, aber auch gebaute Infrastruktur wie Straßen oder Schienennetze. Die Dinge haben mit dem Handeln zu tun. Manchmal werden Dinge aufgrund von Bedarfen entwickelt – Menschen haben begonnen Kleidung zu tragen, um sich vor dem Wetter zu schützen und das Telefon erfunden, um schneller kommunizieren zu können. Aber die Dinge beeinflussen auch unser Verhalten: Wir fahren Zug, wo es eine gute Bahnverbindung gibt, und Auto, wo es Straßen gibt. Im Bereich der Altershilfe gehören zum Beispiel Hilfstechnologien wie Rollatoren oder Hörgeräte und deren Verfügbarkeit zur materiellen Ebene. Aber auch die Gestaltung von Parks und Innenstädten, von Pflege- und Kultureinrichtungen und deren Lage und Erreichbarkeit. Besonders gebaute Infrastrukturen sind oft auf Langfristigkeit ausgelegt und teuer zu verändern.
Die juristische Ebene: Manchmal auch institutionelle Ebene genannt. Diese Ebene meint die Gesamtheit der Gesetze, die eine Gesellschaft strukturieren. Zum Beispiel die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das Grundgesetz, aber auch die Vereinssatzung des Kleingartenvereins, parlamentarische Demokratie, Schulpflicht oder Verkehrsregeln. Auch hier gibt es einen Austausch in zwei Richtungen: Manchmal werden neue Gesetze erlassen, weil es neue Bedarfe gibt, zum Beispiel zum Datenschutz. Manchmal werden veraltete Gesetze abgeschafft, zum Beispiel die Kriminalisierung von Homosexualität. Gesetze und Institutionen haben die Aufgabe, langfristig Orientierung zu schaffen. Es gibt absichtliche Hürden, die verhindern, dass Gesetze schnell geändert werden, um Stabilität zu garantieren, auch wenn es zum Beispiel einen politischen Umschwung gibt. Daher kann es sehr langwierig sein, sie zu verändern und manchmal existieren alte Gesetze noch lange, nachdem sich die öffentliche Meinung geändert hat.
Die kulturelle Ebene: Die kulturelle Ebene liegt zwischen Menschen und meint Übereinkünfte, die nicht juristisch festgelegt sind. Zum Beispiel wen man duzt oder siezt oder, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt. Im Bereich der Altershilfe ist zum Beispiel Teil der kulturellen Ebene, dass alte Menschen mit Mitte 60 üblicherweise in Rente gehen (hier hängt die kulturelle Ebene mit der juristischen Ebene zusammen), oder auch dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alte Menschen im gleichen Ort wie ihre Kinder leben und somit Sorgetätigkeiten außerhalb der Familie organisiert werden müssen. Die kulturelle und die mentale Ebene sind oft schwer voneinander zu trennen. Kulturelle Strukturen können nur kollektiv verändert werden.
Die mentale Ebene: Die mentale Ebene wird manchmal auch inkorporierte Ebene genannt. Das ist, was wir wissen und glauben und uns vorstellen können. Das meint einerseits individuelle Vorstellungen, gleichzeitig werden Vorstellungen auch von der Gesellschaft hergestellt, zum Beispiel durch Erziehung. Im Bereich der Altershilfe gibt es zahlreiche Vorstellungen und Stereotype, wie man zu altern oder sich im Alter zu verhalten hat. Es gibt einerseits ein defizitorientiertes Bild von alten Menschen, gleichzeitig die Erwartungshaltung, möglichst lange ‚jung‘ zu bleiben oder sich jung zu verhalten, dabei aber auf keinen Fall so jung, dass es peinlich ist. ‚Alte‘ werden objektifiziert, das heißt als Objekte gesehen, um die man sich kümmern muss. Aber auch Hierarchien in Pflegeeinrichtungen oder die Vorstellung, dass Pflege mehr mit Liebe als mit Qualifikation zu tun hat, gehören zur mentalen Ebene (eng verzahnt mit der kulturellen Ebene an dieser Stelle). Es gibt sowohl die Ansicht, dass Veränderung der Vorstellungen zu Veränderung des Handelns führen, aber auch umgekehrt kann Veränderung des Handelns auch zu Veränderung von Vorstellungen führen. Alte mentale Strukturen zu ent-lernen oder zu vergessen gilt als noch schwieriger als neue Vorstellungen zu entwickeln.
Diese vier Ebenen des gesellschaftlichen Wandels können helfen zu überlegen, auf welcher Ebene das eigene Projekt agiert und was man vielleicht noch bedenken kann. Es sind nicht die einzigen mögliche Aspekte, unter denen gesellschaftlicher Wandel betrachtet werden kann.
Das Projekt um den PosIA-Index bewegt sich zwischen den Ebenen. Die Förderpraxis zu inspirieren, sozial innovativere Projekte zu fördern hat mit der kulturellen Ebene von Förderstrukturen zu tun. Also welche Art von Projekten wertgeschätzt und mit Geld unterstützt wird. Aber auch die institutionelle Ebene wird adressiert, wenn Förderinstitutionen ihre Förderrichtlinien ändern, zum Beispiel. Die Fragen im PosIA-Index selbst zielen stark auf die mentale Ebene und das Verändern von Alternsbildern ab. Auch zur materiellen Ebene gibt es Fragen – zum Beispiel wie Orte gestaltet sind, an denen Menschen miteinander in Kontakt kommen sollen.

Zwischen Menschlichkeit und Mechanik – Gedanken zu innovativen Erzählungen im Kontext des Romans „Die Bots“
Nina Lauterbach-Dannenberg
Am 26. Juni 2019 nahm ich an einer Tagung des Deutschen Ethikrates in Berlin teil, die sich mit „Pflege – Roboter – Ethik: Ethische Herausforderungen der Technisierung der Pflege“ befasste. Es wurden Möglichkeiten und Grenzen diskutiert, Expert:innen kamen zu Wort, Zukunftsvisionen wurden eröffnet. Mir wurde klar, dass dieses Thema in wenigen Jahren für viele Menschen praktisch relevant sein wird, obwohl sich die meisten heute noch nicht damit auseinandersetzen.
Der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung im Verhältnis zu jüngeren Altersgruppen nimmt vor allem in den Industrienationen stetig zu. Dies trägt zu einer rasant steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen bei. Prognosen legen nahe, dass sich die Zahl der Pflegebedürftigen von 4,9 Millionen im Jahr 2021 auf bis zu 7,25 Millionen im Jahr 2050 erhöhen wird (Bahnsen, 2022). Angesichts dieser Entwicklung stellt sich dringlich die Frage, wie wir diese Menschen sowohl effektiv als auch würdevoll versorgen können – aber auch, wer die Menschen in Anbetracht des Fachkräftemangels versorgen wird. Robotertechnologie und Künstliche Intelligenz versprechen hier Lösungen. Ihre Anwendung wirft jedoch auch tiefgreifende ethische Fragen auf. Technische Unterstützungssysteme, wie beispielsweise in Privatwohnungen installierte Kameras zur Überwachung der Medikamenteneinnahme oder zur Alarmierung bei einem Sturz, berühren tiefgreifend die Privatsphäre, insbesondere in den intimsten Bereichen des Lebens. Gleichzeitig bieten sie jedoch ein erhebliches Maß an Sicherheit. Der Diskurs darüber, ob und in welchem Umfang solche Innovationen genutzt werden sollten, bewegt sich ständig im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Privatsphäre und dem Bedürfnis nach Sicherheit. Der Gedanke, wir könnten in Zukunft von Robotern gepflegt werden, übersteigt dieses bei Weitem und wirft tiefgreifende ethische und soziale Fragen auf. Er fordert uns heraus, über die Grenzen technologischer Innovationen nachzudenken und deren Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen, Würde und das Verständnis von menschlicher Fürsorge neu zu bewerten.
Wie kam es zu der Erzählung „Die Bots“?
Doch niemand liest wohl eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrates am Frühstückstisch; außer man ist fachlich mit dem Thema befasst. Wie können wir also die Menschen erreichen und sie in diesen wichtigen Diskurs einbinden? Es ist essenziell, durch Forschung, Fachwissen und professionelle Analyse zu klären, wie wir die pflegerische Versorgung zukünftig sicherstellen können. Es spielen aber auch die Geschichten, die wir uns erzählen und mit denen wir uns identifizieren können, eine wichtige Rolle – sie sprechen unsere Gefühle an und verstärken das Bewusstsein für diese Thematik. Mit dem Eintritt der Corona-Pandemie veränderte sich unser Alltag merklich, und so entwickelte ich an ruhigen Lockdown-Abenden die fiktive Erzählung „Die Bots“. Sie erzählt von Herbert, Marianna und Susanne, die im nicht mehr allzu fernen Jahre 2032 in einem Altenheim namens „Herbsterwachen“ leben, wo sie ausschließlich von Robotern gepflegt werden. Die Geschichte reflektiert nicht nur den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Pflege, sondern thematisiert auch die Liebe im Alter. (Vielleicht liegt die wahre Innovation darin, dass es selbst im Alter von 90 Jahren noch möglich ist, Liebe zu empfinden und persönliche Weiterentwicklung zu erleben.)
„Die Bots“ ist wohlgemerkt kein Fachbuch. Ich bin keine Expertin für Robotik oder Künstliche Intelligenz in der Medizin und Pflege. Meine berufliche Expertise liegt in der Gerontologie, wodurch ich Strukturen pflegerischer Versorgung und pflegende Menschen kennengelernt habe. Ich betrachte die Entwicklungen im Bereich der Pflege sowohl als Gestalterin, aber vor allem als Beobachterin, ähnlich wie Marianne und Herbert, und stelle mir dieselben Fragen. Meine Geschichte „Die Bots“ spricht keine Wertung für oder gegen Künstliche Intelligenz und Robotik in der (Zukunft der) Pflege aus und nimmt dem/r Leser:in die Wertung nicht ab. Vielmehr lädt sie ein, darüber nachzudenken, wie wir gemeinsam und individuell das Älterwerden gestalten wollen.
An der Schnittstelle von Effizienz und Ethik
Die Einführung von Robotern in die Pflege stellt ein Paradebeispiel für die Verknüpfung von Technologie mit ethischen Fragen dar. Wie können wir sicherstellen, dass diese Technologien die Pflege verbessern, ohne ihre menschliche Qualität zu mindern? Diese Frage ist entscheidend für die Zukunft der Pflege, ein Bereich, der sowohl durch technologische Fortschritte als auch durch das stetige Streben nach Menschlichkeit geprägt ist. Roboter können zweifellos dazu beitragen, die Pflege effizienter zu gestalten und das Personal zu entlasten. Doch es bleibt die Frage, ob sie auch die tieferen emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen erfüllen können. Im Roman „Die Bots“ wird zwar gezeigt, dass Maschinen – die sogenannten „Bots“ – Routineaufgaben übernehmen können, die notwendige menschliche Wärme und emotionale Unterstützung liefern sie jedoch nicht. Diese Einschränkungen werfen wichtige Fragen auf, die über technische Aspekte hinausgehen und die Essenz menschlicher Beziehungen in der Pflege berühren.
Der Leiter der Residenz „Herbsterwachen“ preist bei dem Aufnahmegespräch von Herbert die Bots an: „Ja, natürlich seien die Pflege-Roboter ein würdiger Ersatz für Pflegekräfte aus Fleisch und Blut. Ganz bestimmt! Mehr noch! In einer Zeit, in der das Pflegesystem kurz davorstehe, vollständig zu kollabieren, könnten sie die entscheidende Rettung sein. Und so süß sind sie. Schauen Sie doch mal, diese Kulleraugen! Also, wenn das nicht noch viel mehr als menschlich war. So viel Zuneigung, wie die Bots zu geben hatten, konnte man von einem echten Menschen nicht verlangen.“ (Die Bots, S. 44).
Die Diskussion über Robotik in der Pflege erweitert den Horizont über das Technisch-Machbare hinaus und konfrontiert uns mit tiefgreifenden Fragen der Menschlichkeit. Diese Fragen bleiben zentral, unabhängig davon, wie fortschrittlich unsere Technologien sind, und betonen die Bedeutung von menschlichen Beziehungen innerhalb des Pflegeprozesses. Neben der Frage, ob wir bereit sind, die zwischenmenschliche Komponente zugunsten von Effizienz zu opfern, oder ob wir einen Weg finden, Technologie so einzusetzen, dass sie die menschliche Würde fördert und erhält. In der Diskussion um Robotik und KI in der Pflege wird auch die Frage gestellt: Was kann man von einem pflegenden Menschen verlangen? Letztlich müssen wir als Gesellschaft entscheiden, welche Werte wir in der Pflege priorisieren. Der Einsatz von Robotern in der Pflege könnte zeigen, wie wir Alter, Krankheit und Abhängigkeit wahrnehmen und wertschätzen und damit auch eine Aussage über unsere Wertschätzung gegenüber den Pflegenden machen.
Innovative Erzählungen gehören auch zum Diskurs
Mein Wunsch ist es, nicht lediglich technologische Lösungen zu erforschen oder fachliche Diskurse zu führen. Während diese Aspekte unerlässlich sind, um die Herausforderungen der Pflege in einer alternden Gesellschaft zu bewältigen, dürfen wir die Macht der Narration nicht unterschätzen. Es sind die Geschichten von Individuen, die ihr Altern selbst gestalten, die uns inspirieren und uns neue Wege aufzeigen können. Wir sollten innovative Erzählungen über das Alter(n) fördern, die nicht nur die Probleme, sondern auch die Potenziale des Alterns in den Vordergrund stellen. Diese Geschichten sollen uns daran erinnern, dass jede Person die Fähigkeit hat, ihr eigenes Leben auch im hohen Alter aktiv zu formen. Sie zeigen auf, wie ältere Menschen mit Unterstützung von Technologie und Gemeinschaft weiterhin ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen können, aber auch, welche Verluste damit verbunden sind. Indem wir solche Erzählungen teilen, erweitern wir unser Verständnis davon, was möglich ist, und stärken die Würde jedes Einzelnen. Dies ist entscheidend, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der das Alter nicht als Last, sondern als wertvolle Lebensphase anerkannt wird. Lassen Sie uns daher nicht nur forschen und diskutieren, sondern auch Geschichten erzählen – Geschichten, die sowohl die Herausforderungen als auch die Freuden des Alterns erfassen und die zeigen, wie jeder von uns sein Alter selbst gestalten kann.
Quellennachweise:
Bahnsen, Lewe: Womit in der Zukunft zu rechnen ist: Eine Projektion der Zahl der Pflegebedürftigen. WIP-Kurzanalyse Dezember 2022.
Deutscher Ethikrat., 2020. Stellungnahme: Robotik für gute Pflege. Berlin: Deutscher Ethikrat. https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/stellungnahme-robotik-fuer-gute-pflege.pdf.
Nina Lauter-Dannenbach: Die Bots – eine Novelle um Künstliche Intelligenz und Liebe im Alter, Leichlingen 2024.

